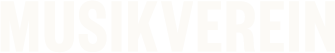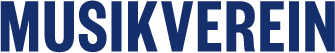Musik des Angedenkens
Dmitrij Schostakowitsch | Igor Levit
Im Schostakowitsch-Gedenkjahr 2025 – fünfzig Jahre nach seinem Tod – macht Igor Levit das Gedenken selbst zum Thema. Fünf Konzerte mit Igor Levit und Musik von Dmitrij Schostakowitsch.
© Felix Broede
„Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von hier? Wenn alle Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr?“ So heißt es in der „Winterreise“, in den Versen von Wilhelm Müller, und heiß legt sich die Musik darüber, die Glut von Schuberts Musik gegen die klirrende Seelenkälte in diesem Lied, „Erstarrung“ genannt. Was festsäße im frostigen Leid, das löst die Musik. Sie bringt Schmerzen, die schweigen müssten, zum Ausdruck. Und sie schafft, wo das trostlose Nichts des Vergessens droht, ein Angedenken. Es ist ein schönes altes Wort, das da mit Müller und Schubert auf uns gekommen ist: Angedenken – das Andenken geht darin auf wie das Gedenken, der Raum öffnet sich für beseeltes Innehalten und gedankenvolles Verinnerlichen eines Gewesenen, das fortwirkt im Hier und Jetzt. Igor Levit hat diese weite Dimension im Blick, wenn er im Schostakowitsch-Jahr 2025 einen Schostakowitsch-Schwerpunkt für den Musikverein gestaltet. Das Gedenkjahr kann da nur äußerlicher Anlass für ein Programm sein, das sich im tieferen Sinn dem Gedenken widmet. Die Musik von Schostakowitsch weckt dabei starke Resonanzen: Beethoven und Liszt klingen auf, Rachmaninow und Ravel – und eben auch Franz Schubert mit seiner Kunst, die „Erstarrung“ zu lösen.
In einer Zeit, die bestialisch auf die Vernichtung des Menschlichen aus war, schrieb Schostakowitsch Musik des Angedenkens: Zartestes, Zerbrechlichstes in seiner Zweiten Klaviersonate, die er 1943 seinem verstorbenen Klavierlehrer widmete. Millionen Menschen wurden umgebracht in diesen Jahren, allein im belagerten Leningrad verhungerte eine Million Zivilisten. Das Massensterben aber verdunkelte nicht den Blick auf das einzelne, ganz individuell gelebte Leben, ja, mehr noch: Umso deutlicher trat im Leid der vielen das unwiederbringlich Kostbare des Einzelnen hervor, das Wunder einer einzigen Lebenslinie – so fragil wie das Lineament in dieser Sonate, mit der Schostakowitsch seines Lehrers Leonid Nikolajew gedachte. Ein Jahr später, 1944, wurde Iwan Sollertinski zu Grabe getragen. „Er war mein nächster und teuerster Freund“, bekannte der trauernde Komponist. „Meine ganze Entwicklung verdanke ich ihm.“ Im Gedenken an ihn schrieb Schostakowitsch sein Klaviertrio Nr. 2, op. 67. Igor Levit kombiniert es mit dem „Trio élégiaque“ von Sergej Rachmaninow – auch dies ein Werk des Gedenkens. Rachmaninow würdigte darin den 1893 verstorbenen Peter Iljitsch Tschaikowskij. Die Zweite Klaviersonate von Schostakowitsch wieder trifft auf Musik von Franz Schubert, Liszt-Transkriptionen von Schubert-Liedern, darunter die „Erstarrung“ aus der „Winterreise“.

© Felix Broede
Im Schatten von Schuberts „Lindenbaum“ suchen auch Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ – gesungen von Günther Groissböck – das Verblühende und bewahren es im Inneren der Kunst. Lebensmelodien, aufgehoben im Melos der Musik. Tief berührend vollzieht sich dies auch bei Maurice Ravel, im ersten seiner „Deux mélodies hébraïques“, „Kaddisch“. Für Igor Levit ist diese kurze, ungemein intime Vertonung des jüdischen Gebets überhaupt die Keimzelle seiner Idee, für seinen Programmschwerpunkt im Musikverein Musik des Gedenkens zusammenzustellen. Instrumental und gesungen steht Ravels „Kaddisch“ als Motto am Beginn von zweien seiner Programme, die selbstverständlich auch groß besetzte Werke umfassen. Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Orchester und Beethovens Viertes Klavierkonzert sind darunter, jeweils mit dem Mahler Chamber Orchestra – Schostakowitsch war, nebenbei bemerkt, auch ein bedeutender Beethoven-Pianist. Doch nicht so sehr um die historische Brücke geht es Igor Levit, wenn er in seinem Schostakowitsch-Projekt auch Beethoven spielt, sondern um die humane Botschaft: Das Gedenken ist immer auch eine Feier des Lebens.
Joachim Reiber