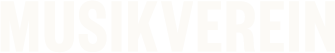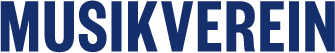Der intime Dialog zwischen Seele und Universum
In der Saison 2025/26 würdigt die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Andris Nelsons mit einem eigenen Konzertzyklus. Der lettische Dirigent ist am Pult der Wiener Philharmoniker und „seines“ Gewandhausorchesters Leipzig im Musikverein zu Gast – und spannt in diesen Konzerten einen weiten programmatischen Bogen von Haydn und Mozart bis zu Wagner und der Komponistin Dora Pejačević.
© Marco Borggreve
Die Reihe Ihrer Fokus-Konzerte beginnen Sie am Pult des Gewandhausorchesters mit Joseph Haydns Symphonie „Der Philosoph“. Weshalb fiel die Wahl auf Haydn, und was schätzen Sie an seiner Musik?
Haydn ist einer der größten Symphoniker überhaupt, seine Bedeutung für die Entwicklung der Gattung Symphonie kann nicht groß genug eingeschätzt werden. Haydns Porträts vermitteln eine eindrucksvolle, Respekt einflößende Persönlichkeit, die er zweifellos auch war. Eine der Herausforderungen liegt darin, dass Haydns Musik viel verlangt – technisch, musikalisch, in intellektueller und emotionaler Hinsicht. Haydns Musik ist ein schmaler Grat, will man die Balance halten zwischen dem, was in der Partitur einerseits und zwischen den Zeilen andererseits steht. Haydns legendärer Humor überrascht immer wieder.
Im zweiten Programm findet sich eine Symphonie in fis-Moll, komponiert von Dora Pejačević – aus Musikvereinsperspektive ein ganz besonderes Werk, wurden doch zwei Sätze davon 1918 im Musikverein erstmals aufgeführt.
Diese Symphonie ist eine wahre Entdeckung! Wir haben sie während der Corona-Zeit in Leipzig zweimal gespielt. Der emotionale Gehalt, die musikalischen Entwicklungen und der Reichtum an Klangfarben, nicht zuletzt durch den Einsatz einer riesigen Orchesterbesetzung, machen sie zu einem wirklich interessanten Werk. Sie ist angenehm fürs Ohr und berührend, komponiert in der sehr persönlichen Sprache dieser Komponistin.
Was können wir alle in der Musikbranche tun, um mehr Komponistinnen in die Konzertprogramme zu bringen?
Es geht einfach darum, sie zu spielen und anzuhören. Es sind manchmal seltsame Gründe, die dazu geführt haben, dass Kompositionen nicht aufgeführt wurden. Wenn wir ein Konzert oder eine Oper hören oder spielen, suchen wir nach einer emotionalen oder intellektuellen oder schlicht menschlichen Erfahrung. Was zählt, ist die Tiefe der Musik, ihr Gehalt, ihre Qualität, vielleicht auch das Neuartige oder einfach die unmittelbaren Empfindungen, die die Musik hervorruft. Wir müssen in die Archive gehen und uns umsehen, aber auch in der Gegenwart. Letztendlich spielt es keine Rolle, ob ein Werk von einer Frau oder von einem Mann komponiert wurde.

© Marco Borggreve
Eines Ihrer Konzerte mit den Wiener Philharmonikern ist Gustav Mahlers Dritter Symphonie gewidmet. Was ist das Besondere am Klang der Wiener Philharmoniker in Bezug auf Mahler, und wonach suchen Sie in der Mahler-Interpretation?
Wenn man sich als Dirigent auf Mahler vorbereitet, tun sich viele Fragen auf – nach dem geeigneten Klang, Ausdruck und vielem mehr. Mahler war vermutlich einer der besten Dirigenten seiner Zeit, natürlich auch für seine eigenen Werke. Seine Einträge in den Partituren sind der optimale Leitfaden für die Interpretation. Könnte man zum Beispiel an einer Stelle verleitet sein, sich etwas mehr Zeit zu lassen, zu genießen, warnt er: „Nicht schleppen!“
Hört man sich frühere Aufnahmen der Wiener Philharmoniker an, beispielsweise mit Bernstein oder Boulez – zwei Antipoden, wie man sich denken könnte –, so ergibt ihre jeweilige Interpretation jedoch immer sofort Sinn, und es erschließt sich, weshalb Mahler diesen oder jenen bestimmten Ausdruck vorgeschrieben hat. Was ich sagen will: Wenn dieses Orchester unter verschiedenen Dirigenten spielt, kommt da doch immer diese schwer zu erklärende DNA zur Geltung, dieses Wiener Gefühl, eine Art Gefühl des Verstehens – es nimmt einen an die Hand und auf die Reise mit, und es lässt einen emotional erfüllt landen. Gleichzeitig sind die Wiener Philharmoniker sehr offen für imaginative Ideenwelten und natürlich für die verschiedenen Wege, die man in der Interpretation gehen kann.
Im letzten Gewandhausorchester-Programm bringen Sie den ersten Aufzug der „Walküre“. Was bedeutet Wagner für Sie? Welche Beziehung haben Sie zu seiner Musik?
Meine erste große Liebe zur Musik galt Richard Wagner. Als ich fünf Jahre alt war, nahmen mich meine Eltern mit ins Opernhaus von Riga zu „Tannhäuser“. Mein Vater hatte mich darauf vorbereitet: Wir hörten Schallplatten, und er erzählte die Geschichte und wie sie unser Leben und Spiritualität widerspiegelt. Diese Musik, es bleibt mir unvergesslich, machte immensen Eindruck auf mich. Im ersten Aufzug der „Walküre“ gibt es fantastische große Opernmomente, aber auch geradezu kammermusikalische Passagen, die diesen Wagner-Akt für den Konzertsaal besonders interessant machen.
Als Dirigent sind Sie permanent von klassischer Musik umgeben. Gibt es auch Leidenschaften außerhalb der Musik?
Ich fühle mich sehr privilegiert, mit all diesen wunderbaren Orchestern auf höchstem Niveau Musik zu machen. Was das Nicht-Musikalische betrifft, interessiere ich mich sehr für Kampfsportarten und mache selbst Taekwondo. Es geht dabei nicht ums Kämpfen als solches, sondern vielmehr um Körpersprache – darum, seine innere Welt durch Bewegung auszudrücken. Als Dirigent gilt es ja nicht nur zu organisieren, sondern in gewisser Weise die eigenen inneren Gefühle über die Musik zu transportieren. Es geht viel um Denkweise, Konzentration, innere Disziplin, inneres Gleichgewicht und eben auch Körpergefühl.
Dann gibt es natürlich meine Leidenschaft für Parfüms …
Wir sind in unserer Zeit von so vielen Problemen und Konflikten umgeben, und viele Menschen haben den Eindruck, dass die Welt auseinanderdriftet. Kann die Musik eine Quelle der Heilung sein?
Davon bin ich überzeugt. Wenn ich daran denke, wie ich es als Kind erlebt habe und wie ich es heute durch die Begegnung mit Orchestern und Publikum auf verschiedenen Kontinenten erlebe, wird deutlich, wie tief, wie aufrichtig und menschlich die Verbindung durch diese Weltsprache der Musik ist. Sie legt die tiefsten Träume, Sehnsüchte und Sorgen der Menschen frei und kann einem emotional, ja fast körperlich Trost spenden. Diese Beziehung, dieser intime Dialog zwischen der eigenen Seele und dem Universum, das die Musik erschafft, ist und bleibt ein Geheimnis.
Markus Siber