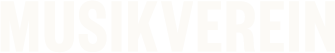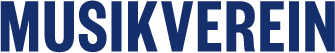Frei in der Musik
Im Herbst 2021, mit 26 Jahren, gab Julia Hagen ihr Debüt bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Zwei Jahre später gewann sie den im Musikverein ausgetragenen UBS Young Artist Award und trat in der Folge mit den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann auf. 2025/26 ist die Salzburger Cellistin Künstlerin im Fokus des Musikvereins und als solche solistisch wie auch kammermusikalisch zu erleben.
© Julia Wesely
Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch im Musikverein? Welche Eindrücke sind damit verbunden?
In der zweiten oder dritten Klasse – ich war in Salzburg im musischen Gymnasium – haben wir eine Wien-Reise gemacht, und unser Musiklehrer hat einen Ausflug in den Musikverein geplant. Wir durften eine Probe besuchen, und man hat sofort gemerkt: Wir waren alle voller Respekt vor diesem Raum. Es ging uns gar nicht so sehr um die Probe, sondern wir haben diese Atmosphäre mitbekommen, diese Geschichte – man hat gespürt, dass das ein wichtiger, besonderer Ort ist. Und als ich dann mit 18 Jahren in Wien studiert habe, war ich ständig am Stehplatz. Ich liebe diese Plätze bis heute und habe ganz viele schöne Erinnerungen in diesem Haus.
Inzwischen sind Sie selbst in den verschiedenen Sälen des Hauses aufgetreten. In der Saison 2025/26 kommen Sie als Künstlerin im Fokus unter anderem mit zwei Kammermusikprogrammen in den Musikverein. Was bedeutet Kammermusik für Sie?
Ich bin mit Kammermusik großgeworden. Mein Vater ist Cellist des Hagen Quartetts, meine ersten Konzerterlebnisse waren Kammermusik. Für mich ist es selbstverständlich, Kammermusik zu spielen: Wenn man eine Gruppe an Leuten gefunden hat, die harmonieren und sich blind verstehen, ist so viel Vertrauen da, dass man frei Musik machen kann – das ist das Schönste. Das gibt es auf diese Weise nur in der Kammermusik.

© Julia Wesely
Im Musikverein konzertieren Sie mit Igor Levit und Sir András Schiff. Was schätzen Sie an diesen prominenten Partnern?
Bei Igor ist immer alles sehr spontan und im Moment, und dabei ist er unfassbar feinfühlig und schnell im Reagieren. Dadurch entstehen auch ohne viele Proben wunderschöne Momente. Wir haben über die Jahre viel gemeinsam gespielt: Es ist sehr vertraut und natürlich und auch sehr einfach, mit ihm Musik zu machen. Bei beiden – Igor Levit und András Schiff – fand ich bewundernswert, egal ob es um mich oder um andere junge Musiker ging: Sie haben einen von Anfang an wie ebenbürtige Kolleginnen und Kollegen betrachtet. András Schiff habe ich beim Studium an der Kronberg Academy kennengelernt. Er ist ein so gebildeter, intellektueller Mensch, und er schafft es gleichzeitig, so emotional zu spielen. Das ist eine seltene Kombination. Dass wir nun die Mendelssohn-Sonate, mit der ich vor Jahren Unterricht bei ihm hatte, gemeinsam spielen, ist unfassbar schön.
Als Künstlerin im Fokus steht für Sie auch Antonín Dvořáks Violoncellokonzert mit den Bamberger Symphonikern unter Jakub Hrůša auf dem Programm.
Mit Jakub Hrůša habe ich bisher noch nicht gearbeitet, aber er ist die Idealbesetzung: Als Tscheche kennt er diese Musik in- und auswendig. Und natürlich dieses Stück: Schon im ersten Orchestertutti, noch bevor ich als Solistin anfange zu spielen, stecken da die schönsten Melodien und Themen drin. Ich finde, dass das Dvořák-Cellokonzert wie große Kammermusik ist, weil so viel Kommunikation zwischen dem Soloinstrument und dem Orchester passiert.
Es heißt, Sie haben sich als Kind im Cellokasten Ihres Vaters versteckt. Haben Sie damals schon geahnt, dass das Violoncello später auch Ihr Instrument sein würde?
So weit habe ich damals nicht gedacht. Aber man sieht: Es war ein sehr spielerischer Zugang. Meine Eltern haben ihre Instrumente nie groß weggesperrt, sie haben uns vier Kindern immer einen natürlichen Umgang mit den Instrumenten erlaubt – zwar vermittelt, dass sie wertvoll sind und man aufpassen muss, aber ohne sie zu heilig zu machen. Das Cello war immer da, und der Cellokasten war ein sehr gutes Versteck. Vielleicht war mir das Instrument deswegen so sympathisch.
Aufgezeichnet von Ulrike Lampert