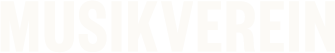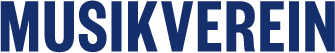Überflügelung
Franz Schubert | Matthias Goerne | Daniil Trifonov
Matthias Goerne und Daniil Trifonov begeben sich mit Franz Schuberts drei großen Liederzyklen auf eine Reise zu sich selbst. Schuberts letzte Klaviersonate rundet den Schwerpunkt ab.
© Marie Staggat | DG
Den Liederzyklus als Gattung hat Franz Schubert genau genommen nicht erfunden: Bei Conradin Kreutzer, Carl Maria von Weber und vor allem in Ludwig van Beethovens „An die ferne Geliebte“ finden sich von Schubert bewunderte Vorbilder. Dennoch hat er sie alle überflügelt mit der „Schönen Müllerin“ D 795 (1823) und der „Winterreise“ D 911 (1828), beide auf Texte von Wilhelm Müller. Nur gut zwei Jahre älter als Schubert war er, der 1794 in Dessau geborene Müller: Als Freiwilliger zog er gegen die Napoleonische Armee ins Feld, er wurde Lehrer und Bibliothekar, arbeitete als Herausgeber, Redakteur und Publizist – und sympathisierte mit der griechischen Revolution gegen die türkische Besatzungsmacht. Bei seinem Tod 1827 hinterließ Wilhelm Müller fünf Gedichtbände, in denen Einflüsse der Romantiker Novalis, Clemens Brentano und Achim von Arnim spürbar sind. Darin hat der salopp „Griechen-Müller“ genannte Autor nicht zuletzt den Boden für Heinrich Heine aufbereitet.
Bei seiner „Schönen Müllerin“ handelt es sich noch um eine Art Liederzählung mit konkreter fortschreitender Handlung und starken Schwankungen der Affekte: Ein Müllerbursch auf Wanderschaft verliebt sich in die Tochter eines wohlhabenden Müllers, verliert sie aber an einen Jäger und geht ins Wasser. Müller mag darin seine unglückliche Liebe zu Luise Hensel verarbeitet haben, der Schwägerin von Felix Mendelssohns Schwester Fanny. Der harmonische Verlauf bei Schubert führt vom anfänglichen B-Dur ins diametral entgegengesetzte E-Dur, eine gleichsam entrückte Tonart, die die finale Rede des Baches in transzendentes Licht taucht: In seinen Fluten hat der Müllerbursch den Freitod gefunden. Die „Winterreise“ hingegen kennt kein folgerichtiges, wenn auch tragisches Ziel mehr – und damit auch nicht eine ähnliche romantische Verklärung, wie sie dem Müllerburschen gewährt wird: In ihren Liedern verbindet sich ein weit einheitlicherer resignativer Grundzug mit dem durchgehenden Motiv ziellosen Weiterwanderns, der transzendentalen Obdachlosigkeit. Die Geschichte und damit auch das gequälte Individuum drehen sich auf beklemmende Weise im Kreis. Ist der abschließende Leiermann ein Hoffnungsschimmer oder ein Symbol für den Tod?
Eine andere Bewandtnis hat es hingegen mit dem sogenannten „Schwanengesang“ D 957, wie der Verleger Tobias Haslinger 1829 die von ihm posthum im Druck veröffentlichten vierzehn Lieder des Komponisten genannt hat. Weder handelt es sich dabei um eine authentische Gesamtgestalt noch um einen in sich geschlossenen Zyklus. Im Gegenteil, der „Schwanengesang“ zerfällt im Wesentlichen in zwei Folgen nach Werken jeweils eines Dichters: sieben Vertonungen nach Ludwig Rellstab sowie sechs nach Heinrich Heine. Schubert hat sie im August und September 1828 in jeweils einem Zug komponiert, weshalb sie somit jeder für sich wenn schon keinen direkt verbundenen Zyklus, so doch einen eigenen Zusammenhang bilden. Während die Rellstab-Lieder in gewisser Weise als stilistische Zusammenfassung von Schuberts bisherigem Liedschaffen erscheinen, zeigen die Heine-Lieder, wie der 31-jährige Komponist nochmals kühn zu ganz neuen Ufern aufbricht – wenige Wochen vor seinem Tod.

© Dario Acosta
„Die schöne Müllerin“, „Winterreise“ und „Schwanengesang“: Diese Schubert-Zyklen bilden vielleicht so etwas wie die Heilige Dreifaltigkeit des deutschen Liedes. Matthias Goerne hat sich sein ganzes Sängerleben immer und immer wieder mit ihnen auseinandergesetzt und sich dabei niemals auf einmal Erreichtes oder Gefundenes verlassen, sondern stets aufs Neue nach Wahrhaftigkeit gesucht. Dabei arbeitet der deutsche Bassbariton auch sowohl mit längst vertrauten wie auch mit aufregenden neuen Partnern am Klavier zusammen – im Musikverein nun mit keinem Geringeren als Daniil Trifonov. Für Goerne ist klar, dass bei diesen Werken unerlässlich ist, „wirklich persönlich zu werden, ohne nur vom eigenen kleinen Leben zu plaudern, sondern die Geschichte mit gemachten Lebenserfahrungen zu verbinden. Es geht nicht nur um eine geistige Durchdringung, sondern eben auch um eine emotionale Durchdringung. Die emotionale Identifikation ist der Schlüssel zum Berühren von Menschen.“
Matthias Goerne wird im Vorfeld der Konzerte in Podcasts und Videos zu den Konzerten Auskunft geben und programmatische Hintergründe erläutern. Die Podcasts und Videos werden vor den Konzerten auf der Multimedia-Seite des Musikvereins veröffentlicht werden.
Walter Weidringer