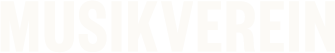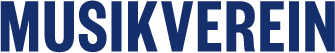Musikverein Festival Beethovens Spazierstock
17. April bis 3. Mai 2026
Wer sich bewegt, bewegt den Geist. Gestützt auf Beethovens Spazierstock bietet das Musikverein Festival 2026 ein fantasievoll bewegtes Programm auf spannenden Wegen und überraschenden Routen.
© Wolf-Dieter Grabner
„Ich hoffe, Ihre Gesundheit gewinnt. Ich glaube, dass Sie mehr Bewegung zu Fuß machen sollen.“ Der Tipp könnte in jedem Fitnessratgeber stehen oder in Ihrer Fitness-App aufpoppen – Sie wissen schon: 10.000 Schritte am Tag! –, aber er stammt von niemand anderem als Ludwig van Beethoven. Nachschrift eines Briefs, den der Komponist im September 1824 an einen Freund aus Baden schrieb. Er selbst, berichtete Beethoven, nütze noch „die schon kürzeren Tage hier im Gebürge wo man sich gern durch Spaziergänge und Genuß der freyen Luft, wie den schönen Gegenden, vor den bevorstehenden Plagen in der Stadt, noch stärken möchte“. Beethoven machte Bewegung zu Fuß – und wie! Er sei „ein sehr guter Fußgänger“ und liebe „stundenlange Spaziergänge, besonders durch wilde und romantische Gegenden“, berichtet ein Zeuge, der mit ihm durchs Helenental wanderte. Ein anderer erlebte, wie Beethoven dort auf schmaler Promenade, hart vorbei an fein gekleideten Herrschaften, den Frack auszog, ihn auf seinen Spazierstock hängte und bloßarmig drauflosging. Dabei schwang er nicht nur den Stock, sondern auch die ausgelassensten Reden.
Diesen Spazierstock findet man heute in den Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Was könnte verlockender sein, als einmal nach ihm zu greifen und mit ihm loszuwandern? Der Musikverein macht sich 2026 exakt so auf den Weg. Mit seinem Festival „Beethovens Spazierstock“ lädt er ein, sich mit Herzenslust auf Reisen zu begeben, wilde Gegenden zu durchstreifen, neue Räume zu erkunden, kühn loszustürmen, sich genüsslich treiben zu lassen oder auch ein Getriebensein zu durchleben, bei dem ein Wanderstab nur noch symbolisch Halt geben kann.
Wieder also ist es ein Objekt aus den reichen Sammlungen des Musikvereins, das den Fluss der Ideen in Gang setzt. Um historisch korrekt zu sein: Ob es exakt dieser Spazierstock war, an dem Beethoven auf der Promenade von Baden den Frack baumeln ließ, wissen wir nicht. Es gibt mehrere Stöcke, von denen gesagt wird, sie wären dem flott gehenden Beethoven dienlich gewesen. Was den Spazierstock in den Sammlungen des Musikvereins auszeichnet, ist der tadellos dokumentierte Gang der Geschichte: Dieser Spazierstock befand sich nachweislich in Beethovens Hand. 1827, wenige Wochen nach seinem Tod, kam er bei der Versteigerung seines Nachlasses unter den Hammer. Anna von Gleichenstein erhielt den Zuschlag, die Schwester von Therese Malfatti, zu der sich Beethoven einst so heftig hingezogen fühlte, dass seine Gedanken sogar Richtung Ehe spazierten. Der kostbare Gehbehelf wanderte weiter und kam 1906 ins Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Neben wertvollen Dokumenten seines Schaffens – Autographen, Skizzen, eigenhändig korrigiertem Aufführungsmaterial – erzählt er als authentisches Objekt von Beethovens Leben. Doch halt! Wirklich trennen kann man das eine nicht vom anderen. Und was speziell den Spazierstock angeht, so weiß man, dass Beethoven die Ideen für sein Schaffen vielfach gehend fand. Stures Sitzen führt zu Sinnesstarre, „wenn wir gehen“, sagt Thomas Bernhard, „kommt mit der Körperbewegung die Geistesbewegung“. Auch das ist einer der vielen reizvollen Aspekte, denen in diesem Festival nachgegangen wird.

© Wolf-Dieter Grabner
Denken wir nur an Gustav Mahler, den Bewegungshungrigen! Er stürmte auf Gipfel, schwamm im eiskalten See, griff in die Ruder und fuhr Rad. Am Attersee saß er dann in seinem Komponierhäuschen und erlauschte die Bewegung in der Musik. „Pan erwacht. Der Sommer marschiert ein“, das war seine Idee für den ersten Satz der Dritten Symphonie, die beim Musikverein Festival ebenso prominent platziert ist (Wiener Philharmoniker / Andris Nelsons) wie die Neunte, mit der das Festival eröffnet wird (Wiener Philharmoniker / Sir Simon Rattle). Gehen, schreiten, marschieren – in der Neunten, der letzten von Mahler vollendeten Symphonie, formt sich der Gang der Musik erst aus einem irritierenden Beginn: Tastend, stockend klingen die ersten Takte – in ihnen, meinte Leonard Bernstein, spiegle sich der unregelmäßige Herzschlag des schon kranken Gustav Mahler. Doch wie auch immer: Das Gehen, Schritt für Schritt, ist wie der Puls, Schlag für Schlag, ein Movens aller Musik.
Mahlers letzte Symphonie wird im „Nachklang“ des Eröffnungskonzerts ergänzt durch das letzte Werk von Luigi Nono, „,Hay que caminar‘ soñando“. Ein Spruch, den Nono an der Wand eines Klosters in Toledo fand, gab die Anregung dazu – auf Deutsch: „Wanderer, es gibt keine Wege, man muss wandern.“ In diesem Sinn setzen auch die Begleitprogramme des Festivals vieles in Gang – in weiteren „Nachklängen“, kuratiert von Marino Formenti, oder, lustvoll flott, auf dem Musikvereinsplatz, wo mit Mauricio Kagel in die Pedale getreten wird: „Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer“. Ungewöhnliche Bewegung dann auch im Großen Musikvereinssaal, wenn Haydns „Militärsymphonie“ gespielt wird (Deutsche Kammerphilharmonie Bremen / Paavo Järvi) – was dort wie abgeht, sei hier noch nicht verraten. In London feierte Haydn seinen größten Erfolg damit, die Reise hatte sich gelohnt für den alten Meister. In Rom wieder langweilte sich der junge Berlioz, er trieb sich lieber in den Abruzzen herum. „Harold en Italie“ erzählt davon – beim Festival zu hören mit dem Bratschisten Antoine Tamestit –, doch was sind die exotischen Streifzüge auf Byrons Spuren gegen die Alptraumreise der „Symphonie fantastique“? Sie wird im Festival von den Wiener Symphonikern gespielt, die mit George Gershwin auch durch Paris flanieren („An Amercian in Paris“). Nach Schottland geht es mit Felix Mendelssohn Bartholdy, nach Italien mit Händel (Bach Consort), mit Tschaikowskij („Souvenir de Florence“, Kammerorchester Wien–Berlin) und mit Franz Liszt. Dessen „Dante-Symphonie“ (Orchester Wiener Akademie) durchquert im Klangrausch höllische Gefilde, während der Teufel in Strawinskys „L’Histoire du soldat“ tückisch diskret auftritt. Petr Popelka präsentiert dieses Werk mit Mitgliedern der Wiener Symphoniker. Lebensreisen, die ins Abgründige führen, erzwungene Lebenswege – auch sie sind ein Thema in diesem Festival, gespiegelt in Werken, die im Exil geschrieben wurden, darunter Korngolds Violinkonzert (London Symphony Orchestra / Vilde Frang) und Bartóks Violakonzert (Wiener Symphoniker / Antoine Tamestit).
„Nun weiter denn, nur weiter, mein treuer Wanderstab“: Die „Winterreise“ darf nicht fehlen in diesem Festival, Schuberts Gang in die tiefsten Seelengründe, gesungen von Andrè Schuen. Ein neues Werk von Georg Friedrich Haas, als österreichische Erstaufführung zu hören mit dem Ensemble Kontrapunkte, greift den Duktus auf: „weiter und weiter und weiter …“. „Wege und Wagnis“ heißt das Festivalprogramm des Black Page Orchestra, Studierende der mdw bewegen sich singend „Am frisch geschnitten Wanderstab“, Markus Meyer liest Robert Walsers „Der Spaziergang“, Max Müller durchstreift auf „Sommerfrische“ altösterreichische Stimmungsgefilde, Michael Köhlmeier erzählt von „Wanderern und Vagabunden“. Bei Allegretto geht’s „In achtzig Tagen um die Welt“, Sebastian und das Tontelefon wieder spazieren keck einer klugen Einsicht nach: „Wer Crescendo sät, wird Forte ernten“. Holla!
Bei solch einem Programm kann es ohne Beethoven, den Sturmerprobten, wohl kaum gehen!
Dass der Eigner des kostbaren Objekts an dieser oder jener Weggabelung auftaucht, versteht sich. „Beethovens Spazierstock“, das Musikverein Festival 2026, bringt selbstverständlich auch die „Pastorale“ (Staatskapelle Berlin / Christian Thielemann), dazu noch die Zweite Symphonie (Berliner Philharmoniker / Kirill Petrenko) und das späte Streichquartett op. 132 (Juilliard String Quartet). Welche Musik aber ging Beethoven durch den Kopf, als er einst von Baden losspazierte – weiter und weiter und schließlich so weit, dass er abends im 30 Kilometer entfernten Wiener Neustadt herauskam? Abgekämpft, abgesandelt irrte er durch den Ort – man hielt ihn für einen Landstreicher, arretierte ihn und glaubte so lange nicht seinem Beteuern, er sei Beethoven, bis man nächtens den Musikdirektor der Stadt herausläutete. Und der bezeugte es: Das ist Beethoven! Ob der wilde Wanderer damals seinen Spazierstock dabeihatte, ist nicht überliefert.
Joachim Reiber